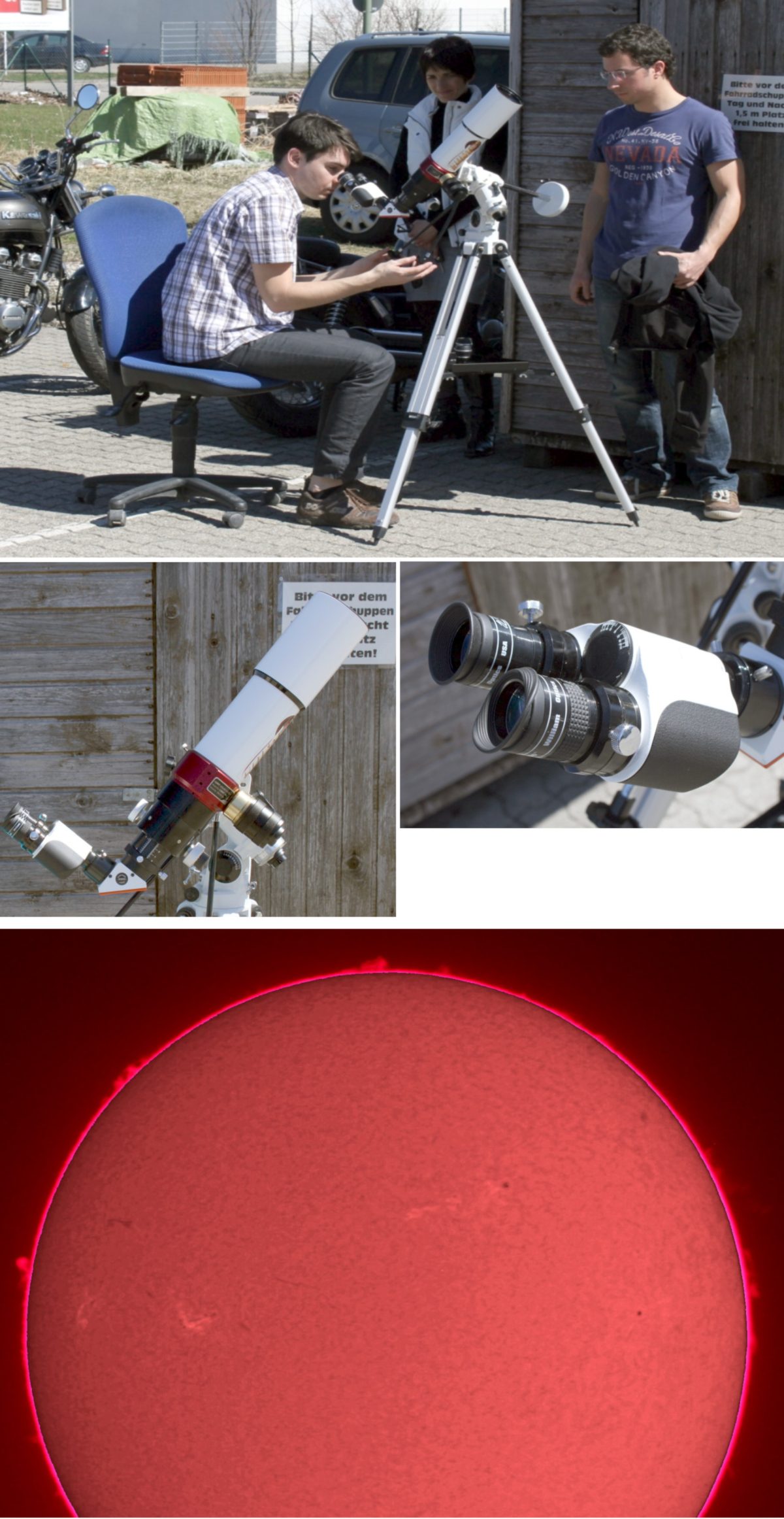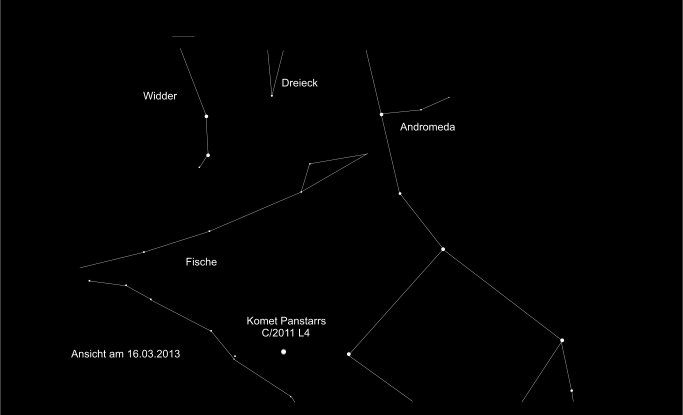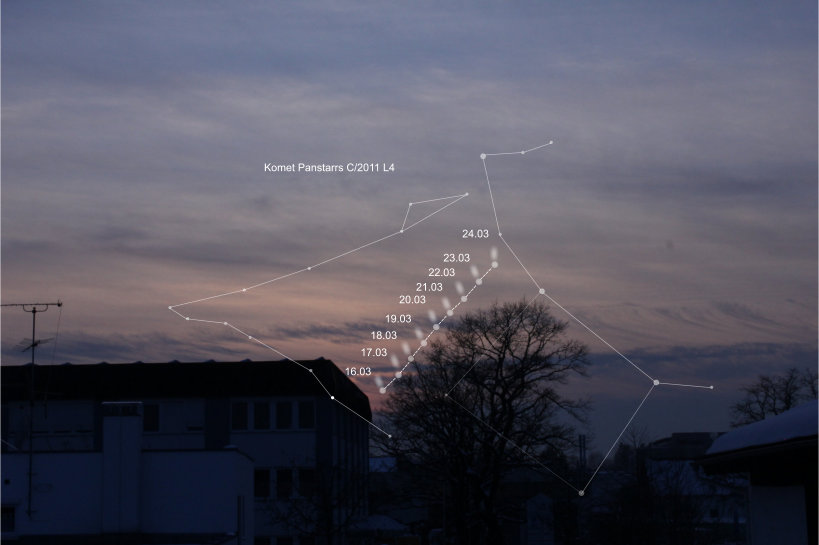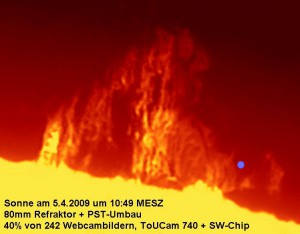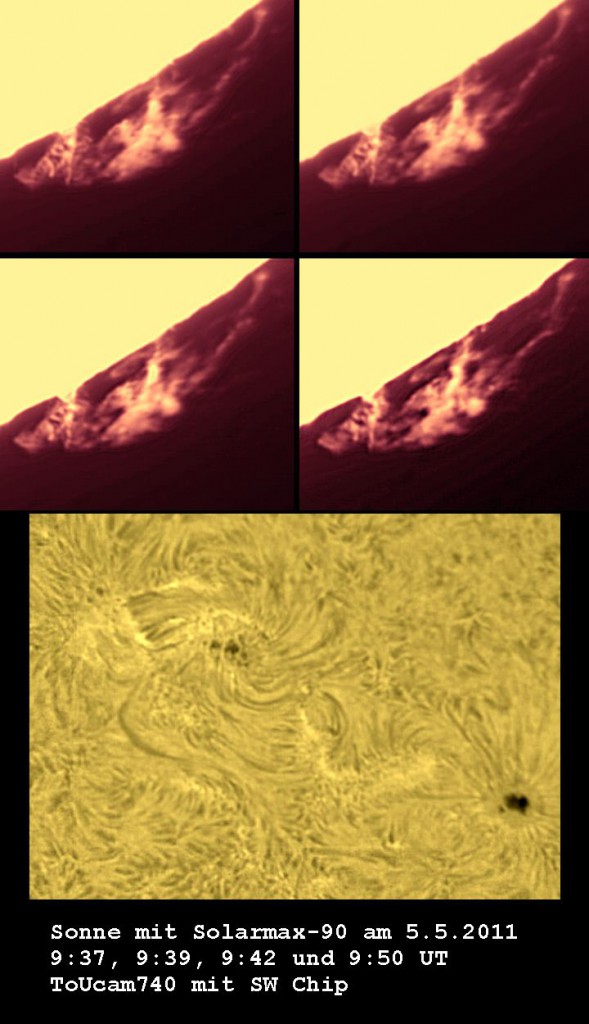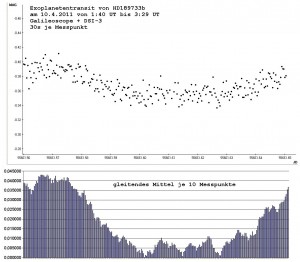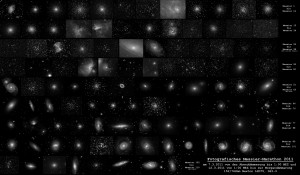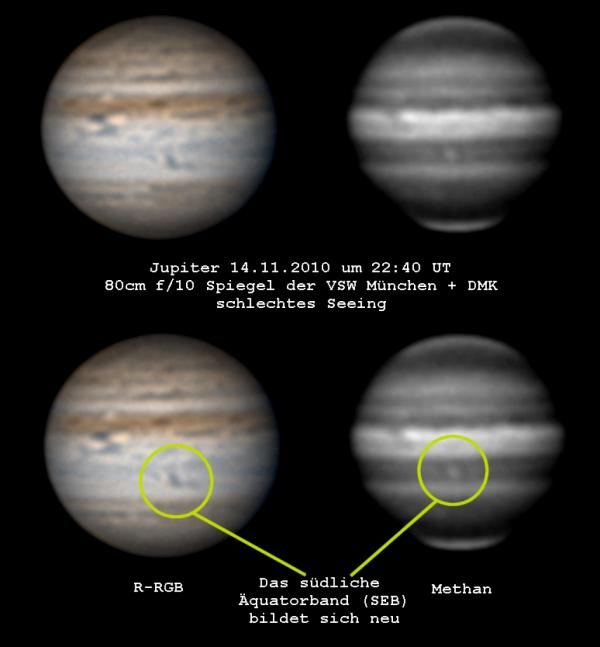Was kann man eigentlich alles mit einem Teleskop für Einsteiger beobachten? Welche Teleskopgröße benötige ich, damit ich Details auf den Planeten oder die entfernten Deep Sky Objekte erkennen kann? Viele Amateurastronomen streben im Laufe der Jahre zu immer größeren Teleskopöffnungen, um immer besser in die lichtschwachen Bereiche vordringen zu können.
Doch was ist mit den kleineren Teleskopen? Viele Anfänger interessieren sich dafür, was man mit einem günstigen, kleinen Teleskop beobachten kann. Es ist zu Beginn nicht ganz leicht, den hunderte Teleskope stehen zur Auswahl. Was ist wohl für mich das richtige Teleskop? Beispielfotos gibt es kaum.
Omegon 130/920mm Teleskop in der Praxis
Als Amateurastronom ist es manchmal garnicht so schlecht wieder einmal durch ein kleineres Teleskop zu schauen. Man sieht, was schon mit kleinen Optiken möglich ist. Die letzte Nacht zeigte sich von der besten Seite. Nach langer Durststrecke gab es wieder einmal einen sternenklaren Himmel. Ich nutzte die Gelegenheit, das Omegon 130/920mm Teleskop auf eine EQ-6 Montierung zu setzen und Himmelsobjekte zu beobachten.
Ein Planet, ein Ring, eine neue Leidenschaft
Saturn ragte im Süden über die Bäume hinaus und war eines der ersten Objekte. Mit einem 130mm Newton Teleskop erkennt man die Planetenkugel und den großen Ring, der majestätisch um die Kugel zu schweben scheint. Im Ring erkennt man leichte Helligkeitsunterschiede und die berühmte Cassiniteilung ist angedeutet. Doch auch die Planetenscheibe selbst ist nicht ohne Kontur. Über die Kugel zieht sich ein dunkler Wolkenstreifen. Schon mit einem 130mm Teleskop können Sie als Einsteiger faszinierende Astronomie erleben. Mit dem bloßem Auge ist der Saturn ja noch ein Stern. Spätestens wenn Sie das erste Mal diesen „Stern“ als Planeten sehen, sind Sie begeistert. So war es auch bei mir, als ich als Jugendlicher das erste mal diesen Planeten durch mein Teleskop sah.
Hinaus in die Weiten
Auch Deep-Sky, also die Beobachtung von Nebel-Objekten außerhalb unseres Sonnensystems ist möglich. Der berühmte Kugelsternhaufen M13 zeigte sich als helles Objekt. In der Mitte erscheint er noch sehr verwaschen, Einzelsterne tauchen nur ganz am Rand auf. Doch mit dem Wissen es ist eines Randobjekte unserer eigenen Galaxie steigt die Faszination Weltall ins wahrhaft unermessliche.

Kugelsternhaufen M13 mit dem Omegon 130/920mm Teleskop. Aufgenommen mit Watec Kamera
Der Ringnebel ist ebenso ein sehr lohnendes Objekt für Einsteigerteleskope. Dieser Planetarische Nebel sieht tatsächlich wie ein Rauchring aus. Da er sehr hell ist, können Sie sogar recht hoch vergrößern.

Der Ringnebel aufgenommen durch das Omegon 130/920mm Teleskop mit der Watec Kamera
Galaxien gehören normalerweise nicht zu den Vorzeigeobjekten dieses Teleskops. Doch ich stellte ein paar Vertreter dieser Klasse mal ein. Die berühmte Strudelgalaxie M51 in den Jagdhunden thronte fast im Zenit. Visuell sah man zwei Kernregionen, die etwas nebelhaftes um ihre Kerne geschlungen hatten.
Auch das Galaxienpaar M81 und M82 zeigte sich im Omegon 130mm Teleskop. Was würde man sehen bei diesen hellen Galaxien? M81 ließ ihr helles Zentrum durchblicken und M82 zeigte ihre übliche Form, die an eine Zigarre erinnert. Diese Galaxien gehören zu einem benachbarten Galaxienhaufen und sind etwa 12 Millionen Lichtjahre entfernt.
 Die Strudelgalaxie M51 aufgenommen mit dem Omegon 130/920mm Teleskop. Die Spiralen kommen visuell nicht so durch, wie man es auf dem Bild sieht |
 Die Galaxie M82 im Großen Bären aufgenommen mit Omegon 130/920mm Teleskop. Visuell sieht man die Zigarre aber nicht sie Strukturen innerhalb der Galaxie |
Ein solider Schnupperkurs durch das Universum
Mit dem Omegon 130/920mm Teleskop können Sie also auch schon ganz prima in die Astronomie einsteigen. Dieses Teleskop begleitet Sie bei den ersten Gehversuchen durch die praktische Astronomie. Es nimmt Sie mit in eine Welt, die Ihnen vielleicht vorher noch verborgen war. Und vielleicht löst es ja auch bei Ihnen eine Faszination aus, die ein ganzes Leben lang hält?